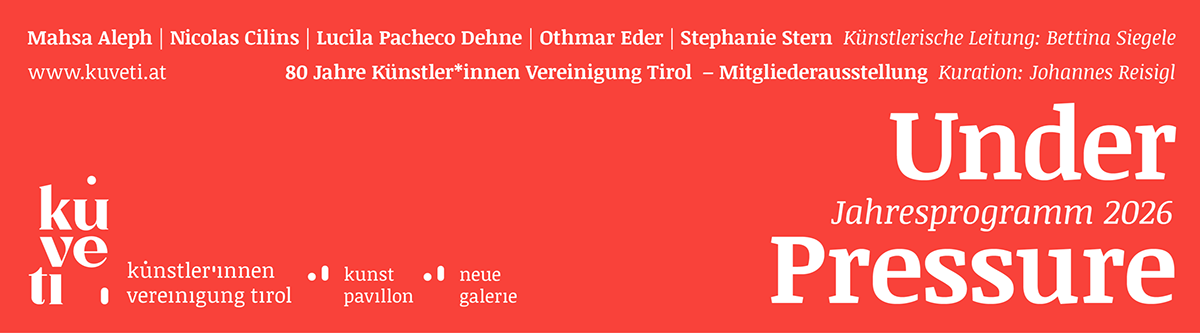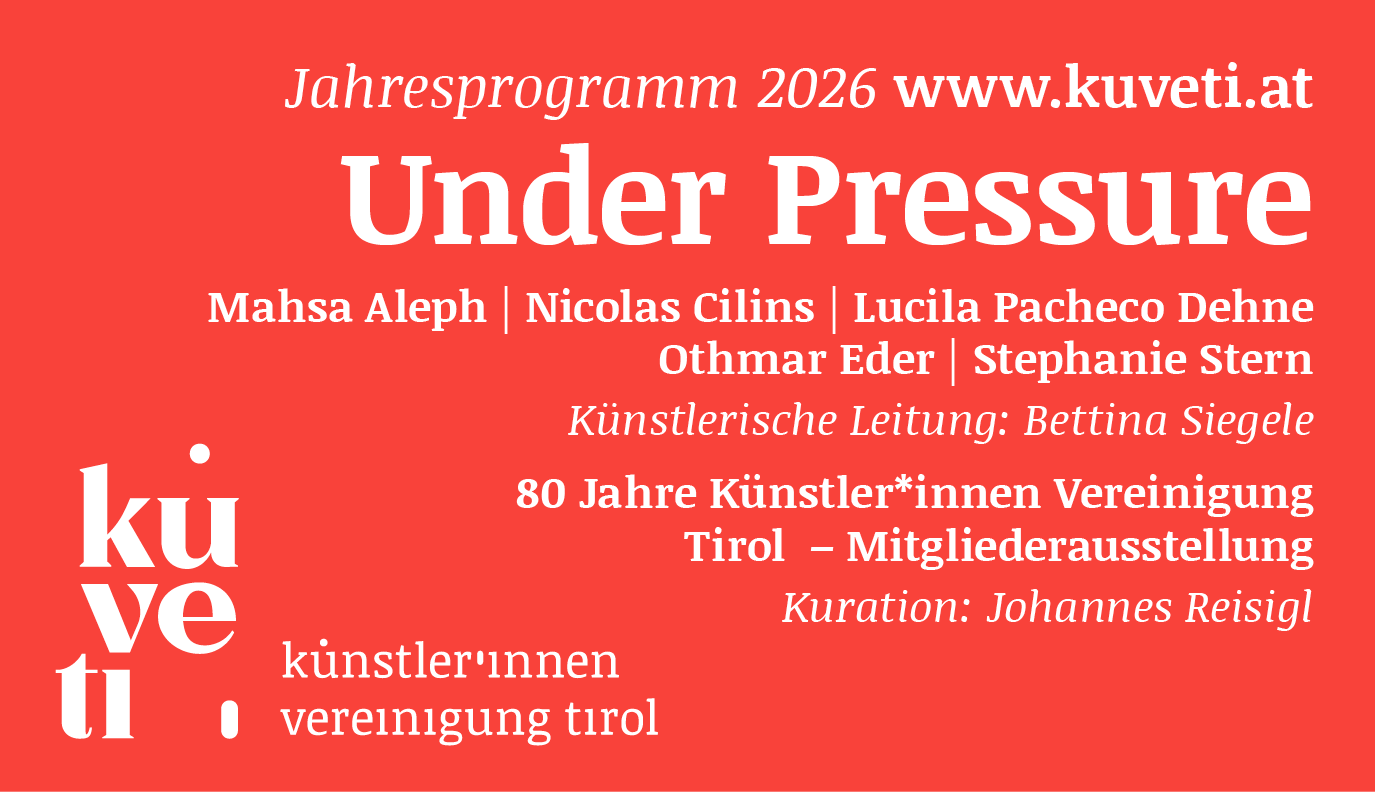Die Themen für ihre Installationen und Performances entwickeln sich meist organisch, beim gemeinsamen Tun – oder beim Nichtstun – und beim Austausch verschiedener Disziplinen und Persönlichkeiten. Wie sie sagen: „Meistens wählen wir die Themen nicht; sie entstehen aus dem Dialog zwischen uns, unserem Umfeld und den Medien, die wir bedienen. Um die Vielfalt der Eindrücke, Inspirationen und Themen zu ordnen, entwickeln sie die „ZAK-Methode“, die „die Flut an Material organisiert und neue Verbindungen schafft“. Dabei wird die eigene Arbeitsweise oft selbst zum Thema – mit Fragen wie: „Was bedeutet Produktivität?“ und „Wie schafft man Räume für diverse Formate und Menschen?“

In ihrem wachsenden Kosmos aus Mythen und Figuren sind Performance und Installation untrennbar verwoben. Ihre Arbeitsweise basiert auf Spiel, Wiederverwertung und Kontextverschiebung. Ein Kostüm kann der Ausgangspunkt für einen Film sein, der wiederum einen Soundtrack inspiriert, wodurch ein Theaterstück oder eine Bustour entsteht. In ihren eigenen Worten: „Die Produkte unserer Zusammenarbeit sind wie Spielzeuge in einer Truhe, die wir immer wieder neu zusammensetzen.“ ZAK arbeitet oft jenseits institutioneller Strukturen; ihre Arbeiten kamen bisher nicht ins Visier politischer Angriffe. Gesellschaftliche Entwicklungen beobachten sie jedoch genau – zu deutlich zeigt sich, dass die individuelle Freiheit längst nicht mehr nur eine künstlerische, sondern eine existenzielle Frage geworden ist. Sie erinnern sich an ein einschneidendes Erlebnis: Bei einem Einbruch in ihr Studio wurde eine Malerei mit einem nackten Frauenkörper mutwillig durch fünf Schnitte zerstört.
Sie reagierten darauf mit einem kollektiven Heilungsprozess: Besucher:innen nähten die Schnitte eigenhändig zu. So wurde aus einem Übergriff ein „Akt des Widerstands und der gemeinsamen Stärke“. Verletzlichkeit sichtbar zu machen und die kollektive Handlungsfähigkeit zu erweitern, ist ein weiterer Aspekt ihrer Arbeit. Was die Praxis ihrer Gemeinschaft auszeichnet, ist die Erkenntnis des „kollektiven Genies“ und der Wille, sich auf intimste Weise begegnen und konfrontieren zu wollen – mit allen Emotionen und Absurditäten. Dieser Zugang erlaubt es ihnen, „offen und experimentell zu bleiben und sich selbst nicht zu ernst zu nehmen – ganz nach dem Motto: „Stay peinlich“.
Zentrum für antidisziplinäre Kunst (ZAK) – www.instagram.com/zak_antidisziplinaer/
Der Beitrag ist Teil der Sonderausgabe »DATING ALIENS«, die für die Parallel Vienna 2025 produziert wurde. Link zur Sonderausgabe